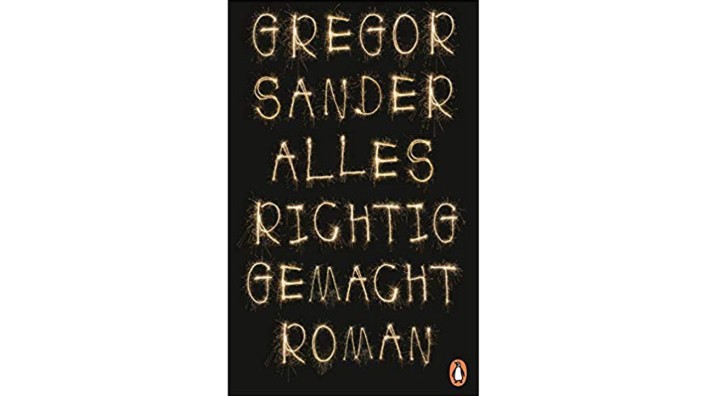So also lebt der Berliner von etwa fünfzig Jahren. Er steckt fest in einer kriselnden Ehe und lenkt sich ab mit seinem Anwaltsalltag. Er nimmt zu und er erinnert sich. Und zu erinnern gibt es viel, weshalb Gregor Sanders Roman "Alles richtig gemacht" eine ostdeutsche Vergangenheit erzählt, deren Zentrum die Beziehung des Ich-Erzählers Thomas Piepenburg zu seinem Jugendfreund Daniel bildet. Über vier Jahrzehnte kehrt dieser in immer neuen Konstellationen in sein Leben zurück. So auch zu Beginn der Erzählung, an dem er nach zehn Jahren eines dunklen Abends auf der Rückbank von Thomas' Auto auftaucht, um mit ihm halbe Hähnchen im Wedding zu essen.
So wird er den folgenden Erinnerungsepisoden zum Anlass, die sich mit der tristen Gegenwart des Anwalts abwechseln, sich ihr langsam nähern und diese wohl auch in ihrer Abenteuerhaftigkeit kontrastieren. Ja, da war viel Leben in der Rostocker Jugend, auf einer Irlandreise und später im Berlin der Neunziger- und Nullerjahre. Da ist die Drogerie des Vaters, die nach der Wende insolvent wird, in Lichtenhagen tauchen die Nazis auf, am Ostseestrand die ukrainischen Kinder, die sich von Tschernobyl erholen. In Irland weilt man zufällig unter Schafen, während in Schottland Dolly geklont wird, und New York besucht man kurz nach dem 11. September. Dasselbe in der Gegenwart: Als Anwalt verteidigt Thomas Piepenburg einen Islamisten und zudem soll er für einen Investor Wohnungsräumungen durchsetzen.
Diese Kulissen der Zeitgeschichte ver helfen der Erzählung trotzdem nicht zu einer eigenständigen Relevanz. Die wäre vielleicht entstanden, hätte Sander die Wechselwirkung zwischen Zeitgeschichte und Person, das, was sie in ihnen bewirkte und für sie bedeutete, zum Stoff seiner Erzählung gemacht. Wenn sie in ihnen erschienen wäre und nicht um sie herum. Sie bleibt aber zumeist Kulisse, und wenn sie doch einwirkt, bleiben die Kausalitäten mechanisch: der Vater begeht nach der Insolvenz Selbstmord, Daniel wird als linke "Zecke" von den Nazis verprügelt und verlässt Rostock. Kaum eine innere Entwicklung ist zu spüren bei den Protagonisten, nur wenige Spuren der Ereignisse sind auffindbar.
Der Autor zählt lediglich auf, was zu erzählen wäre
Sanders Blick nach innen ist ungeduldig, seine Sprache bleibt floskelhaft. "Er war wie ein Teil von mir, der mir vorher gefehlt hatte", beschreibt Thomas die Freundschaft zu Daniel. Wirklich bedauerlich wird das Fehlen einer eigenen Sprache bei tragischen Ereignissen, die Raum für persönliches Erleben eröffnen könnten.
Stattdessen heißt es zum Beispiel am Grab des Vaters: "Er war einfach immer da gewesen. Das war er jetzt nicht mehr, und das traf mich mit einer Wucht, mit der ich nicht gerechnet hatte. Dass uns keine Zeit blieb, für nichts mehr. Dass er in seiner Not mit niemandem geredet hatte, nicht mit mir und auch nicht mit seiner Frau. Dass er mit dem Tod seines übermächtigen Vaters wohl den eigenen Tod als Chance begriff." Und dann geht es schon wieder weiter, mehr Zeit hat Sander nicht, den Freitod zu ergründen, und keine Sätze, seine Wirkung erfahrbar werden zu lassen.
Gregor Sander zählt lediglich auf, was zu erzählen wäre. "Mein Hemd ist aus der Hose gerutscht", stellt Thomas irgendwann fest, "und eine Schicht Schwabbel, wie Stephanie das nennt, leuchtet über dem Hosenbund. Ich hasse das. Entweder ich muss mir weitere Hemden kaufen oder doch abspecken."
Selbstbetrachtungen dieser Art finden sich viele im Laufe der Handlung, denen man ihren exemplarischen Charakter wohl nicht absprechen kann, die die Erzählung aber erdnah halten, weil hinter allem Geschehenden keine Idee erkennbar ist, die es transzendierte. Es findet sich viel Wirklichkeit in diesem Roman, aber wenig Wahrheit.